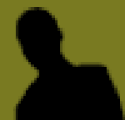Wie stehen die rechtlichen Chancen des Aktionärs auf Ersatz der erlittenen Kursverluste?
„Auf der Grundlage des im Jahr 2007 deutlich verbesserten Verkehrsmix sieht die Austrian Airlines Group optimistisch in die Zukunft.
… Bereits für 2009 strebt [sie] … einen dividendenfähigen Gewinn an.“
In: Geschäftsbericht 2007, Seite 62, (datiert: 6.2.2008, veröffentlicht: 12.3.2008)
- Im Geschäftsbericht 2007) (Seite 9) ist unter der Überschrift „STRATEGIE – Zukunft erfolgreich gestalten“ zu lesen: „Die Austrian Airlines Group strebt als mittel- und langfristiges Ziel eine dauerhafte Steigerung des Unternehmenswertes für ihre Aktionäre an. Die erfolgreiche Durchführung von Restrukturierungsmaßnahmen hat die Offensivkraft der Gruppe dafür im abgelaufenen Jahr deutlich gestärkt.“
- Die drei Vorstandsmitglieder Alfred Ötsch (CEO), Andreas Bierwirth (CCO) und Peter Malanik (COO) schreiben im 1. Quartalsbericht vom 24.4.2008) an die sehr geehrten AktionärInnen (Seite 4): „Wir haben durch die wieder gewonnene Stärke unserer finanziellen Basis die Möglichkeit, auch in schwierigen Zeiten in unsere Stärken zu investieren und somit unseren Vorsprung in unseren Kernmärkten auszubauen. … Durch die geplante Beteiligung des Geschäftsmanns Sheikh Mohammed Bin Issa Al Jaber im Rahmen einer Kapitalerhöhung, die am 7. Mai der Hauptversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt wird, erfolgt eine weitere wichtige strategische Weichenstellung für die Zukunft der Austrian Airlines Group.“
- Im Halbjahresfinanzbericht vom 29. Juli 2008) berichtet „Investors Relations” weitwendig (Seite 14), dass Sheik Al Jaber die jungen Aktien nicht zeichnete und die AUA deshalb in einem ersten Schritt die vereinbarten Garantien einklagte. Sie verzichtete aber auf jeden Hinweis, dass die Boston Consulting Group (BCG) am 9.6.2008 beauftragt wurde, zusätzliche Potentiale aus einer strategischen Partnerschaft auszuloten und bereits zwei Wochen später interessante Partneroptionen identifizierte. Die drei Vorstandsmitglieder blicken weiterhin optimistisch in die Zukunft (Seite 3): „Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen können wir auf unsere erfolgreiche strategische Positionierung aufbauen. Sowohl externe als auch interne Faktoren sprechen für uns. Die erfolgreich abgeschlossene Redimensionierung der Langstrecke, die positive Entwicklung der Nettoverschuldung und des Net Gearings über die Jahre und die gut aufgestellte Flotte schaffen ein solides Fundament.“
Eine Fülle von Investoren vertrauen Unternehmensinformationen und zeichneten zum Beispiel im Mai 1999 junge AUA-Aktien zum Kurs von € 27,70. Die Kurse rauschten in den Keller und nicht wenige Aktionäre fühlten sich von „ihrem“ Unternehmen hinters Licht geführt. Trotz – oder wegen – der rechtlichen Rahmenbedingungen sind ihre praktischen Chancen, Kursverluste ersetzt zu bekommen, äußerst bescheiden und der Weg dorthin steinig und kostspielig:
Der Gesetzgeber hat die Informationspflicht normiert (zB § 48d BörsenG) und für irreführende Erläuterungen Sanktionen (§ 255 AktG, § 146ff StGB) vorgesehen. Er wollte durch die Errichtung einer operativ unabhängigen Finanzmarktaufsicht die Stabilität des Finanzplatzes Österreich stärken, die Effizienz der Aufsicht verbessern und den bestmöglichen Schutz der Investoren gewährleisten. Es wird interessant zu beobachten sein, wie die Anklagebehörde mit dem von Sheik Al Jaber behaupteten zahlreichen Verstößen gegen das Aktiengesetz sowie fortlaufender Täuschungshandlungen durch CEO Alfred Ötsch umgehen wird.
Zivilrechtlich haben Aktionäre fünf Jahre Zeit, gegen Vorstandsmitglieder zu klagen, die die Sorgfaltspflicht verletzten (§ 84 AktG). Darüber hinaus hat der Österreichische Arbeitskreis für Corporate Governance Wohlverhaltensregeln für verantwortungsvolle Unternehmensführung (Corporate Governance Kodex) erlassen, um durch die freiwilligen Selbstregulierungsmaßnahmen das Vertrauen der Aktionäre maßgeblich zu fördern. In der Präambel heißt es: „Der Kodex verfolgt das Ziel einer verantwortlichen, auf nachhaltige und langfristige Wertschaffung ausgerichteten Leitung und Kontrolle von Gesellschaften und Konzernen“ (Hervorhebungen von mir). Selbst wenn dieser Kodex von den börsennotierten Unternehmen akzeptiert wird, bedeutet das aber noch lange nicht, dass diese auch alle unverbindlichen Regeln anwenden. Dazu ein Beispiel:
„Die Gesellschaft legt im Konzernlagebericht eine angemessene Analyse des Geschäftsverlaufes vor und beschreibt darin wesentliche finanzielle und nicht-finanzielle Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, wie Branchenrisiken, geographische Risiken, Zinsen, Währungen, Derivativgeschäfte und Off -balance- sheet – Transaktionen, sowie die wesentlichen eingesetzten Risikomanagement-Instrumente“ (Regel C67).
Ich kann mir schwer vorstellen, dass selbst bei großzügiger Interpretation dieses Textes jemand feststellt, dass der Konzernlagebericht der AUA dem entspricht. Und wenn? Da aus nicht beachteten unverbindlichen Regeln keine Sanktionen erwachsen können, bleibt der Privataktionär einmal mehr auf der Strecke.